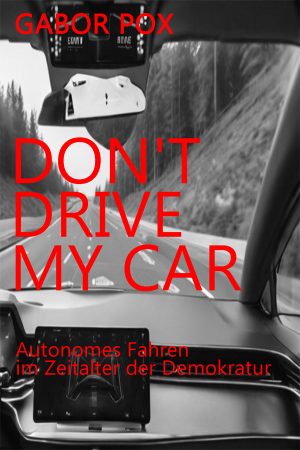Literatur
Presse
Bücher von Gabor Pox
Don't drive my car
Gabor Pox
APPLE Books & Amazon & Google Books
Dieses Kapitel ist ein Auszug aus meinem Buch „Don’t drive my car“. Als E-Book erhältlich bei Apple Books, Amazon und Google Books. Aus aktuellem Anlass biete ich den folgenden Text als Artikel in einer Wochenzeitung oder Fachzeitschrift an.
Autonomes Fahren im Zeitalter der Demokratur
Was verbindet autonomes Fahren und Demokratur derzeit besser als die plötzliche Annäherung und Freundschaft zwischen den beiden großen Männern Amerikas? Ja, ich rede über Donald Trump und Elon Musk. Der erste, der frisch gewählte „Dejà-vu-Präsident”, der König der MAGA-Bewegung, ist nach Ansicht der Demokraten auf dem besten Weg, die amerikanische Demokratie in eine Demokratur zu verwandeln. Und der zweite, der hochmotivierte „best billionaire„, der der ganzen Welt immer wieder zeigt, dass sich Überstunden lohnen, ist auf dem besten Weg, die Bühne des oben erwähnten politischen Theaters zu betreten.
Lassen wir uns ein wenig ins Detail gehen. Elon Musk ist ein Genie, das steht außer Frage. Klar ist auch, dass es ihm völlig egal ist, ob er sympathisch wirkt oder nicht. Sein Motto lautet: Erfolg schafft Sympathie. Das kann stimmen. Mein mittlerweile erwachsener Sohn ist so fasziniert von Elon und seinen vielen Unternehmungen, dass er nur noch Tesla fährt und monatelang ein Reportagevideo geplant und vorbereitet hat, in dem ein ganzer Arbeitstag von Elon Musk mit einer Körperkamera, die er selbst trägt, gefilmt wird. Man sieht, was Elon sieht. Man hört, was Elon sagt. Ob die Menschen, die wirklich zu sehen sind und auch etwas zu sagen haben, mit den Aufnahmen glücklich und einverstanden sind, bleibt offen. Das Projekt mit dem Titel „18 Hours for Elon“ ruht derzeit, ein passender Tag wird vielleicht noch gesucht. Die politische Großwetterlage könnte ein Showstopper sein. Elon Musk hat jedoch viele wichtige Unternehmen und Projekte: Tesla (Elektrofahrzeuge), SpaceX (Weltraumforschung und Raumfahrzeuge), Starlink (Satellitennetzwerk für das weltweite Internet), X (soziales Netzwerk, ehemals Twitter), Neuralink (Neurotechnologie), The Boring Company (tunnelbasierte Fahrzeugsysteme), X.AI (Unternehmen für künstliche Intelligenz).
Aber bleiben wir bei Tesla. Amateurvideos auf YouTube zeigen, wie gut Tesla bereits autonom fahren kann. Allerdings bisher nur in den USA. Die deutschen Vorschriften erlauben nicht einmal Level 3 für Tesla, sie dürfen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Buches nur Level 2 fahren. Deutsche Autohersteller wie Mercedes-Benz und BMW dürfen mehr, sie fahren bereits Level 3 auf ausgewählten Strecken. Das hört sich gut an, das suggeriert, die beiden seien besser als Tesla. Mein Eindruck, nachdem ich das erwähnte Video gesehen habe, ist, dass das nicht der Fall ist. Fakt: Die deutschen Automobilhersteller haben derzeit andere Probleme und die Entwicklung des autonomen Fahrens könnte sich mangels Masse verzögern.
Wie gesagt, Tesla macht seine Hausaufgaben erstaunlich gut und verwendet in der aktuellen Hardware-Version 3 (HW3) nur Kameras. Die Tesla-Entwickler erklären die Technik so: Ein menschlicher Fahrer hat nur zwei Augen, kein Radar (Schallwellen) und kein LiDAR (Lasertechnologie). Und der Mensch kann trotzdem gut fahren. Der Tesla hat viele Kameras. Die sind besser als die zwei Augen des Menschen. Und das Gehirn? Das wird jeden Tag besser. Dafür wurde das SDV (Software Defined Vehicle) erfunden.
Jedoch gab Elon Musk in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen des dritten Quartals 2024 zu, dass man sich nicht sicher sei, ob HW3 jemals vollständig autonomes Fahren ohne Überwachung unterstützen wird. Diese Aussage stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Ehrlichkeit und Transparenz dar. Denn bislang hatte Tesla immer auf die Zukunftssicherheit von HW3 gesetzt. Musk erklärte in der Konferenz, dass HW4, die neuere Version der Hardware, deutlich leistungsfähiger sei. „Es besteht die Möglichkeit, dass HW3 nicht das Sicherheitsniveau erreicht, das für ein autonomes Fahren ohne menschliche Aufsicht erforderlich ist“, so Musk… Nicht nur Hersteller wie Audi, BMW, Ford, Volvo und Waymo haben das Potenzial von LiDAR erkannt. Auch Tesla setzt nun anscheinend auf die fortschrittliche Sensortechnologie – und das, nachdem Elon Musk LiDAR zuvor als “Irrweg” bezeichnet hatte. (Pressemitteilungen 2024)
Was hat das mit Demokratur zu tun?
Zunächst einmal, dass eine starke Verbindung zwischen einem hoch favorisierten Autohersteller und einer Demokratur-Politik (einschließlich Importzöllen und Subventionen) die Spielregeln des Straßenverkehrs beeinflussen kann. Tesla könnte – zumindest in den USA – noch erfolgreicher sein. Zweitens, dass es in Europa immer mehr Länder gibt (auch Deutschland gehört seit der Trump-Wahl dazu), die auf der Navigationsroute A (Demokratie) -> B („Autonomes Fahren“ ohne Regierung) -> C (Demokratur) unterwegs sind.
Natürlich gibt es auch andere amerikanische Unternehmen, die sich mit dem autonomen Fahren beschäftigen. Nehmen wir zum Beispiel Waymo. Das Unternehmen betreibt Robotaxis in San Francisco. Die Fahrzeuge beherrschen bereits Level 5. Die Fahrgäste müssen den Fahrersitz freihalten und dürfen weder das Lenkrad noch andere Instrumente anfassen. Für Problemfälle steht eine Remote-Hotline zur Verfügung, die über Kamerabilder die Steuerung des Fahrzeugs übernehmen kann. Zusammenfassend kann man sagen: Die Taxis fahren sehr sicher, aber zu langsam, was in einer verstopften Großstadt verständlich ist. Die Autos sind auffällig, jeder sieht, dass es sich um ein Robotaxi handelt. Da die Waymos – wie auch die Teslas – beim Anhalten hinter einem anderen Fahrzeug immer viel Platz lassen, ergibt sich bei einer Verengung oft folgendes Szenario: Die manuell gesteuerten Fahrzeuge drängeln sich ständig aus der anderen Spur, und der Waymo muss warten. Nach 10 Minuten werden die Fahrgäste nervös. Was wäre die Lösung? Weniger Abstand. Und immer dann, wenn sich ein fremdes Fahrzeug in die Lücke drängt, etwas nach vorne fahren. Es gibt aber auch positive Beispiele, wenn manuell fahrende Personen ein Roboterfahrzeug erkennen und helfen.
Ausgehend vom letzten Fall gibt es eine weitere Herausforderung. Solange nur ein autonomes Fahrzeug unterwegs ist, kann es auf die Unterstützung der anderen Teilnehmer zählen (eigentlich nicht das Fahrzeug, sondern die Programmierer). Aber was passiert, wenn alle autonom fahren? Typische amerikanische Kreuzung: Nebenstraßen, vier Stoppschilder. Wer fährt zuerst los? Natürlich der, der zuerst angehalten hat. So weit, so gut. Aber wenn sie gleichzeitig ankommen? Hierfür wäre es eigentlich denkbar, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Ein kleines Zoom-Meeting oder doch lieber ein Losverfahren?
Auch die TU München arbeitet an Lösungen für das autonome Fahren. Wie ich auf dem AutomotiveIT.carSummit (der natürlich am Tag der Wiederwahl von Donald Trump stattfand) erfahren habe, haben die Entwickler der TUM einige extreme Szenarien für die Testfahrten gewählt. Das waren zum einen spektakuläre Autorennen im Formel-1-Stil (A2RL in Abu Dhabi und IAC in Indianapolis), bei denen nicht nur viel Erfahrung gesammelt wurde, sondern TUM auch die Rennen gewann. Eine weitere Extremsituation war der Einsatz des TUM-Shuttles „EDGAR“. Während die Rennwagen in einem menschenleeren Raum um den Sieg kämpften, war der Einsatzort von EDGAR das Oktoberfest (Wiesen) 2024. Zwischen Tausenden von teilweise betrunkenen Menschen, unentschlossenen Radfahrern, verzweifelten Fahrzeuglenkern und chaotischen Straßensperren zu fahren, war eine echte Herausforderung. Das Ziel konnte nur erreicht werden, indem das autonome System davon ausging, dass sich NIEMAND an eine Regel hält, d.h. eine grüne Ampel bedeutet keinen Vorteil.
Die meisten Autos von heute und morgen sind Software Designed Vehicles (SDV). Das bedeutet, dass das Auto regelmäßig Updates erhält und ständig eine Vielzahl von Daten an ein zentrales System übermittelt.
Als Entscheidungsgrundlage für die Fahraktionen fallen im autonomen Auto pro Minute fünf Gigabyte Daten zur Verarbeitung an. Die Rechenleistung an Bord kommt ungefähr der von 15 Laptops gleich. Zukunftsfahrzeuge sollen das Verkehrsgeschehen für rund zehn Sekunden vorausberechnen können und alle möglichen Verkehrsszenarien beherrschen, und zwar überall auf der Welt. Und die Systeme müssen in Zukunft nicht nur verkehrs-, sondern auch datensicher entwickelt sein, um mögliche Cyberangriffe abwehren zu können. Die Zahlen zeigen, vor welch großen Herausforderungen die Autohersteller stehen. (ADAC 2024)
Auf der AutomotiveIT-Veranstaltung habe ich immer wieder „Open Source“ als Softwarequelle gehört. Als ich nach den Risiken fragte, kam die Antwort – es ist kein Risiko, es ist eine Voraussetzung. Letzteres kann ich gut nachvollziehen, denn ich bin selbst Softwareentwickler. Zur Erinnerung: als Open Source bekommt man Funktionsbausteine, manchmal komplette Systeme, die von frei verfügbaren Programmierern als virtuelles Team entwickelt werden. Die offizielle Definition lautet:
Open-Source-Software (OSS) ist Computersoftware, die unter einer Lizenz veröffentlicht wird, in der der Urheberrechtsinhaber den Benutzern das Recht einräumt, die Software und ihren Quellcode zu verwenden, zu untersuchen, zu ändern und an jedermann und für jeden Zweck weiterzugeben. Open-Source-Software kann in gemeinschaftlicher, öffentlicher Weise entwickelt werden. Open-Source-Software ist ein prominentes Beispiel für offene Zusammenarbeit, d. h. jeder fähige Benutzer kann online an der Entwicklung teilnehmen, wodurch die Zahl der möglichen Mitwirkenden unbegrenzt ist. Die Möglichkeit, den Code zu prüfen, stärkt das öffentliche Vertrauen in die Software. (Wikipedia)
Es stellt sich die Frage, wie die Daten- und Codesicherheit gewährleistet werden kann, wenn Unbekannte nachträglich Anpassungen an der Software vornehmen können. Es ist natürlich richtig, dass die Software für autonomes Fahren offengelegt werden muss, um die Funktionsweise und die Entscheidungskriterien zu zeigen, damit die Behörden und auch die Fahrzeughalter z.B. überprüfen können, welche ethischen Regeln in Extremsituationen angewendet werden, um Menschenleben zu schützen. Sicher wäre es natürlich, nur die fertige Software offen zu legen, ohne unsichere Quellen zu nutzen. Es wäre aber unfair, wenn ein SDV-Hersteller die Software nur für sich entwickelt, sie aber am Ende allen zur Wiederverwendung zur Verfügung stellt. Glücklicherweise gibt es bereits unzählige KI-Systeme, die Quellen auf schädlichen Code überprüfen können. Die große Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Codesicherheit, Kostenersparnis durch Wiederverwendung und Transparenz durch Offenlegung zu finden. Ich würde sagen, dass Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel die Durchführung eines Updates, nicht auf Open-Source-Basis entwickelt werden sollten.
Doch zurück zur Demokratur. Brauchen wir eine starke zentrale Koordination? Ob in der Politik oder beim autonomen Fahren? Oder ist es besser, alles dezentral zu regeln? Manchmal wünsche ich mir eine Weltregierung statt eines Flickenteppichs von Regierungen, unter dem der Klimaschutz leidet, weil jeder etwas anderes für wichtig hält. Gilt das auch für den Straßenverkehr? Wie im Buch „Don’t drive my car“ dargestellt wird: Fremde Planeten wie Wega haben sich für ein zentrales System entschieden, Deep Arch kontrolliert alles. Die Fahrzeuge müssen nicht denken. Ein Homo Sapiens würde sagen, das ist ein Risiko, was ist, wenn der Supercomputer abstürzt? Stürzen dann alle Flugfahrzeuge ab? (Sie könnten natürlich stehen bleiben…) Die Weganer würden sagen, ihr Erdbewohner, ihr habt nur eine zentrale Sonne, was ist, wenn das Licht ausgeht? Oder hat jeder von euch einen kleinen Reaktor zu Hause, um Licht und Energie zu ersetzen? Nein, das haben wir nicht. Nicht alle. Aber unsere Erfahrung sagt uns, dass ein Computer viel öfter abstürzt als eine Sonne untergeht. Hat das etwas mit menschlichem Versagen, mit Qualitätsproblemen oder mit Gott zu tun? Natürlich nicht.
Ich denke, wir brauchen Demokratie und nicht Demokratur. Sind wir uns da einig? Und wir brauchen autonomes Fahren, das so verteilt ist, dass die Zentrale schwer zu finden ist.
Buchdetails:
Titel: „Don’t drive my car“
Untertitel: „Autonomes Fahren im Zeitalter der Demokratur“
Autor: Gabor Pox
Verlag: artishock.de
ISBN: 978-3-00-081027-5
Erscheinungsdatum: 06.12.2024
Preis E-Book: 5,99 EUR
About Us
artishock.info
Portal für Literatur, Musik, Fotografie und Künstliche Intelligenz